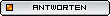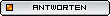Die elektronische Gesundheitskarte (eGK) soll das zentrale ?Ausweispapier? des Patienten werden. Doch die Entwicklung stockt. Jetzt laufen die Kassenärzte Sturm.
 eGK: Schnellere und bessere medizinische Versorgung
eGK: Schnellere und bessere medizinische Versorgung
Das kann jeden von uns treffen: Ein Mensch wird nach einem Unfall ins Krankenhaus gebracht. Über den Patienten weiß der Arzt nichts. Deshalb schiebt er eine kleine Karte in ein Lesegerät. Auf dem Computer erscheinen daraufhin Infos darüber, wie der zu Behandelnde heißt, wie alt er ist, wo er wohnt, dazu Infos zu Blutgruppe und eventuellen chronischen Erkrankungen. Auch auf die Krankenakte (inklusive Befunde oder Röntgenbilder) erhält er Zugriff ? und leitet so schnell die richtigen Maßnahmen ein. Möglich machen soll das in Zukunft die elektronische Gesundheitskarte.
Funktionsumfang zum Start dürftig
Rund 600 Millionen Euro kostete die Entwicklung der eGK bislang. 2004 erfolgte der Startschuss für das Projekt; 2006 sollte die Karte schon starten. Doch daraus wurde nichts. Sicherheitsbedenken und der Vorwurf, die eGK erhöhe den bürokratischen Aufwand, führten dazu, dass die Verantwortlichen den Funktionsumfang der eGK nach und nach zusammenstrichen. Auf der eGK sind jetzt nur die Stammdaten der Patienten enthalten, wie sie auch auf der derzeitigen Versichertenkarte verzeichnet sind. Dazu kommen ein Passfoto und die Wohnadresse. Wer mag, macht freiwillige Angaben etwa zu vorhandenen Allergien. Eine PIN (ähnlich wie bei einer EC-Karte) schützt vor unbefugtem Zugriff.
Zukunftsmusik: Patientenakte, Organspendeausweis, Rezeptmodul
Eigentlich sollte die eGK darüber hinaus viel mehr können, etwa einen Zugriff auf die komplette Patientenakte erlauben, einen Organspendeausweis sowie die Möglichkeit, Rezepte elektronisch auszustellen und in einer Apotheke einzulösen, enthalten. Diese Module sollen folgen ? Datum: unbekannt.
Die Sache mit dem Datenschutz
Ein Hauptproblem sehen Datenschützer in der für die flächendeckende und vollwertige Nutzung der eGK erforderlichen Infrastruktur: Nicht nur die etwa 80 Millionen Bundesbürger müssen mit den Karten ausgestattet werden. Hinzu kommen Terminals in allen Krankenhäusern, Artzpraxen und Apotheken und gewaltige Server, auf denen die Patientendaten für den Zugriff über die eGK gespeichert sind. Bauchschmerzen bereiten Sicherheitsexperten auch die über eine eGK möglichen sogenannten Mehrwertdienste. So lassen sich theoretisch Praxisgebühr, Selbstzahlerleistungen, Zuzahlungen oder Eigenanteile bargeldlos über die Karte abwickeln oder eine Jahresaufstellung der für Gesundheitsleistungen aufgewendeten Beträge an das Finanzamt schicken.

Was aber, fragte schon 2008 der Chaos Computer Club, wenn etwa aufgrund der durch die Nutzung der Mehrwertdienste erfolgten Datenweitergabe die Patientendaten an Dritte gelangen? Die IT-Experten werfen der für die eGK zuständigen Betreibergesellschaft Gematik unter anderem vor, dass sie auf die Daten zugreifen könnte ? und damit theoretisch auch Behörden.
eGK: Ein Milliardengeschäft
Die elektronische Gesundheitskarte gibt es nicht zum Nulltarif. Bezahlen müssen Sie für die eGK zwar nichts, der Betrieb soll aber in Zukunft über die Krankenkassenbeiträge gedeckt werden. Zuständig für das System ist die Gematik, die wiederum Aufträge an IT-Unternehmen vergibt. Nach einer Studie der europäischen Kommission birgt die Vernetzung des Gesundheitswesens ein Umsatzpotenzial von 50 bis 60 Milliarden Euro.
Die Bevölkerung sieht der Einführung der eGK offenbar gelassen entgegen: Nach einer Umfrage des Hightechverbandes Bitkom sprechen sich 70 Prozent der Menschen für die Karte aus.
Neuer Wirbel um die eGK
Seitdem die eGK 2011 verbindlich eingeführt wurde, blieb es rund um das Thema relativ ruhig. Die Krankenkassen haben die Karte an die Patienten verschickt; die Projektgesellschaft Gematik arbeitet an den Funktionen, die nach und nach freigeschaltet werden sollen.
Doch jetzt steht das Projekt vor großen Problemen. Auslöser ist ein Beschluss der Vertreter der nordrheinischen Vertragsärzte vom 10. Mai 2013. Auf einer Tagung beschlossen die Mediziner einstimmig, dass ihr Dachverband ?Kassenärztliche Bundesvereinigung? aus der Gematik und damit aus dem Projekt eGK aussteigen soll.
Ärzte befürchten Mehraufwand
Hintergrund ist ein Streit über die Mechanik, die für den Datenabgleich zwischen den Ärzten und der Gematik-Datenbank, Verwendung findet. Einmal pro Quartal ist ein Abgleich der Patientendaten der Ärzte mit denen auf den Gesundheitskarten vorgesehen. Hierzu soll ein eigenes Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) bei der Gematik installiert werden. Das wiederum ruft einen Mehraufwand in den Praxen hervor, monieren die Ärzte: ?Der Stammdatenabgleich ist eine administrative Aufgabe, die eine monströse Bürokratie zum Schaden der Versorgung und der Patienten in die Arztpraxen bringen würde?, so Wieland Dietrich, Vorsitzender der Freien Ärzteschaft.
Krankenkassen in der Pflicht?
Stattdessen sollen die Krankenkassen den Datenabgleich vornehmen. Hierzu gebe es bereits die sogenannte Kiosk-Lösung, argumentieren die Ärzte. Hierbei werden die Patientendaten über eine Station mit den Daten auf der eGK abgeglichen und so auf den neuesten Stand gebracht. Doch bei der Gematik stießen sie mit ihrem Vorschlag auf Granit: Im März 2013 lehnte das Unternehmen den Vorschlag ab, wobei die Vertreter der Krankenkassen mehrheitlich gegen das Vorhaben stimmten.
Austritt nur ein Symbol
Ob die Kassenärztliche Bundesvereinigung dem Ansinnen der Ärzte tatsächlich folgt und die Mitarbeit bei der Gematik einstellt, steht nicht fest. Allerdings könnte das Bundesgesundheitsministerium die Vereinigung zur Rückkehr in die Gematik zwingen, sodass es sich beim Austritt eventuell nur um eine symbolischen Akt handelt. Der Vorfall zeigt aber, wie fragil das ganze System eGK noch ist und dass bis zur vollen Funktionalität noch viel Zeit ins Land gehen wird.
Quelle